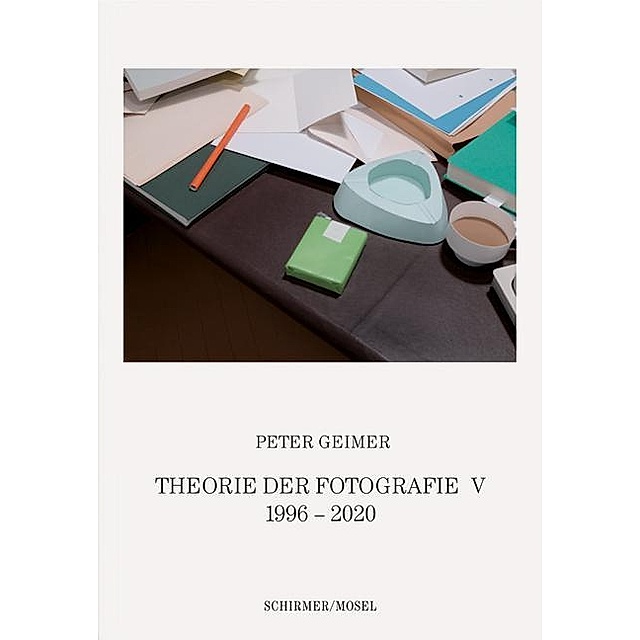
Der fünfte Band der Serie von kommentierten Anthologien zur „Theorie der Fotografie“ beschäftigt sich mit einem Zeitabschnitt, in dem gewaltige technologische Umbrüche ebenso gewaltige Umbrüche in den Theorien über die Fotografie selbst hervorgebracht haben. In den letzten drei Jahrzehnten hat die digitale Fotografie die Möglichkeiten des Mediums unerhört ausgeweitet – und ich spreche hier nicht von der Bilderflut auf Instagram und anderen sozialen Netzwerken. Oft unter dem Radar der Beschäftigung mit Fotografie gibt es das breite Feld der „bildgebenden Techniken“ z. B. in der Medizin; die explosionsartige Vermehrung von fotografischen Methoden der Überwachung; und natürlich die verschwimmende Grenze zwischen statischem und bewegten Bild. „Gear-affine“ Internetsurfer*innen wissen ja, das immer öfter bei der Präsentation neuer Kamerasystem mit den Videoqualitäten geworben wird.
Die letzten Jahrzehnte haben natürlich auch neue theoretische und philosophische Versuche mit sich gebracht, den Übergang vom Analogen zum Digitalen zu verstehen, zu interpretieren und neu zu definieren. Auch auf dem weiten Feld der Fotografie gilt das alte Bonmot Mark Twains, der einen fälschlich auf ihn veröffentlichten Nachruf mit den Worten kommentierte, die Nachricht über seinen Tod sei stark übertrieben. Auch der Tod der Fotografie ist, meiner bescheidenen Meinung nach, noch keineswegs zu diagnostizieren.
Die Bände der „Theorie der Fotografie“ sind deswegen so spannend, weil sie – egal wie verschroben die eine oder andere „Theorie“ auch sein mag – zeigen, wie unterschiedlich die Beschäftigung mit dem Medium sein kann. Ich gebe ja zu, dass mein Zugang zur Fotografie wesentlich simpler gestrickt ist als jener zahlreicher Autor*innen der vorgestellten Texte. Das liegt eventuell daran, dass ich nach wie vor beim Herangehen an philosophische „Schulen“ zunächst vom Gegensatz zwischen Idealismus und Materialismus (der „Grundfrage der Philosophie“) ausgehe und danach an die „Feinjustierung“ gehe. Und ich zweifle ernsthaft an, ob die überwiegende Mehrzahl der modernen Denker*innen außer geheimnisvoll-dräuenden Wortungetümen tatsächlich fundamental neue philosophische Erkenntnisse offerieren können.
Ein schönes Beispiel ist für mich z.B. Daniel Rubinsteins Text „Das digitale Bild“, der eine „tiefgreifende Unbegreifbarkeit des Bildes“ postuliert (S. 122). Und es geht weiter:
„Der Zustand des ‚Unberechenbar-Werdens‘ deutet auf spekulative Weise darauf hin, dass das digitale und vernetzte Bild überhaupt kein Bild ist, sondern vielmehr eine zweidimensionale Teilmenge eines vierdimensionalen Objekts, das wir für gewöhnlich als ‚Internet“ bezeichnen„.
Die zwingende Schlussfolgerung aus Rubinsteins Thesen ist für mich, dass „die Fotografie“ nicht (mehr) existiert, wodurch man „eine neue Ontologie“ des Mediums brauche. Aha. Rubinsteins Denkansatz ist spannend und äußerst provokativ – die praktische Nutzanwendung ist mir aber unklar. Gewiss kann man die Milliarden im Internet kursierenden Bilder, die tatsächlich nichts anderes als Bits und Bytes sind, als Ja/Nein-Schaltungen, als eben solche zur Kenntnis nehmen. Für ihre Schöpfer*innen und Betrachter*innen aber sind diese Datenklumpen wesentlich mehr, nämlich Fotografien, die ganz unterschiedlich ästhetische, emotionale oder der Information dienende Bedürfnisse befriedigen. Auf wundersame Weise lassen sich besagte Datenklumpen ja dann doch wieder auf einem materiellen Träger fixieren. Die Hersteller von Fotodruckern, Printstationen in Supermärkten oder Anbieter von Fotobüchern, Kalendern etc. können ein profitables Lied davon singen.
In erstaunlich vielen der jüngsten Texte zur Fotografie ist die „Technik“ hinter dem Bild das zentrale Thema. Aber: wie entscheidend ist es wirklich, ob das „Schreiben mit Licht“ auf einer beschichtenen Platte oder einem lichtempfindlichen Rollfilm stattfindet, oder eben auf einem elektronischen Sensor? Immer wieder wurde und wird die „Manipulierbarkeit“ des Digitalfotos beschworen – als hätte es Retuschen oder gar echte Fälschungen in der Dunkelkammer nie gegeben. Wer David Kings epochales Buch „Die Kommissare verschwinden“ über die stalinistischen Bildfälschungen kennt weiß, was alles durch Retuschen am Negativ oder, brutaler, mit Schere, Cuttermesser und Pinsel möglich war. Klar – heutzutage kann ich sogar gratis im Internet Personen und Objekte auf Fotografien freistellen, über die Ebenenwerkzeuge der meisten Bildbearbeitungsprogramm zusammenfügen, nach Herzenslust Eingriffe vornehmen, die aus der bloßen Retusche das weitgehende „Composing“ machen. Aber, nochmals – das alles sind verfeinerte und vor allem schnellere Nachbauten von Methoden der Bildveränderung, die es auch in der Analogiefotografie gab. Welche Auswirkungen die Entwicklungen auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz haben werden, ist eine andere Diskussion.
A propos andere Diskussion: ausgesprochen amüsant finde ich Text 7 der Anthologie, Margaret Olins „Berührende Fotografien. Roland Barthes ‚irrtümliche‘ Identifizierung“, in dem sich die amerikanische Kunsthistorikerin mit einem erstaunlichen Irrtum in Roland Barthes berühmten Text „Die helle Kammer“ auseinandersetzt. Kurz zur Erinnerung – Barthes spricht von „studium“ und „punctum“, wenn es um Fotografie geht. Das „studium“ ist, vereinfacht gesagt, das, was uns ein Foto auf Grund unserer Erkenntnisstruktur vermittelt – das „Bild“. Aus dieser Information heraus „sticht“ das Punctum den Betrachter, die Betrachterin, Es ist das, was uns an einer Fotografie „packt“, was uns berührt, was uns emotional trifft (auch hier, meiner Meinung nach, wieder eine Bestätigung, dass auch sogenannte „neuere“ Theorien oft nur anders formulierte alte Positionen beschreiben. Ich denke hier an Walter Benjamins Aura-Begriff, der meiner Auffassung nach „die Mutter aller punctums“ ist).
Olin zeigt nun, dass Barthes bei der Beschreibung eines Bildes des afromaerikanischen Fotografen James Van der Zees ein „punctum“ (eine Halskette) memoriert, das dort gar nicht vorhanden ist, sondern aus einem Familienbild der Barthes „hereingerutscht“ ist. Das Faszinierende an diesem Text ist nicht nur der ausgesprochen ironische Unterton in einigen Passagen des Essays, es ist auch die „Erdung“ des Texts von Barthes. Offenbar kann auch die brillantest formulierte Theorie durch eine Fehlleistung des menschlichen Gehirns (des Gedächtnisses) ins Straucheln geraten.
Geoffrey Batchens Text „Vernakulare Formen der Fotografie“ aus dem Jahr 2000 zeigt, wie man anregende Überlegungen durch – pardon – verschwurbelte Sprache auf das Niveau einer Geheimwissenschaft heben (oder senken?) kann. Beispiel gefällig?
„Genau wie vernakulare Formen der Fotografie selbst die angenommene Unterscheidung zwischen Haptik und Sichtbarkeit sowie zwischen der physischen und der konzeptuellen Identität der Fotografie implodieren lassen, müssen wir eine ebenso komplexe historische Morphologie für fotografische Bedeutung produzieren Diese vernakulare Semiologie des Fotografischen (oder genauer, diese Fotogrammatologie) ist die notwendige Eruption der Geschichte der Fotografie, mit der ich begonnen habe, (…)“. (S. 220).
Zum Glück schafft es Herausgeber Peter Geimer in seiner Vorbemerkung zu diesem Text, dessen Kernaussage prägnant darzustellen.
Spannend und ausgesprochen witzig ist ein Text des Anthropologen und Kunsthistorikers Christopher Pinney, der westliche Deutungsmuster der Fotografie in ein Verhältnis zu außereuropäischen Traditionen setzt. Neben einem ausgesprochen amüsanten Rückblick auf die Interpretation der Fotografie als etwas Magischen im neunzehnten Jahrhundert liefert er auch eine sehr schöne Fußnote zu der von mir erwähnten Peircschen Terminologie von Indexikalität und Ikon.
„Frazer skizziert eine Theorie von Zeichen und Ursachen. Es ist eine Übung darin, was später ‚Semiologie‘ genannt werden sollte. Der herumwirbelnde Halbschatten von ethnografischen und klassischen Fußnoten in The Golden Bough scheint Generationen überzeugt zu haben, dass dies lediglich eine literarische Erkundung von Mythen sei, und machte sie blind dafür, die Parallele zum »Ikonischen« und ‚Indexikalıschen‘ in der Peirceschen Semiotik zu erkennen. […].“ (S. 237)
Vor dem Hintergrund des Krieges in und gegen die Ukraine sowie der Feuerwalze über Gaza und dem Westjordanland ist Abschnitt 5, „Politik der Bilder. Schauplätze photographische Evidenz“ von ganz besonderer Bedeutung.
Helmut Lethens Beitrag zur Geschichte der mittlerweile selbst bereits Historie gewordenen Wehrmachtsausstellung und ihre beiden Varianten legt beredtes Zeugnis davon ab, wie schwer der Umgang mit schrecklichen Fotos ist. Zu Recht weist Lethen auf den Unterschied zwischen Fotos hin, die für sich sprechen und die Betrachter*in unmittelbar berühren, und Fotos, denen juristischer Beweischarakter zugeordnet werden soll.
Klar, dass in diesem Zusammenhang weder Susan Sontag nach Judith Butler fehlen dürfen. Unabhängig von allen anderen wissenschaftlichen und politischen Positionen Butlers ist meiner Meinung nach ihrer kritischen Haltung gegenüber Sontag in ihrem Text aus dem Jahr 2009 über die Wirkung der berüchtigten Fotos aus Abu Ghraib zuzustimmen: „In diesem Fall hat die Zirkulation der Bilder außerhalb des Schauplatzes ihrer Entstehung den Mechanismus der Leugnung durchbrochen und zu Trauer und Empörung geführt“. (S. 280).

Jacque Rancières Aufsatz „Das unerträgliche Bild“ aus dem Jahr 2008 thematisiert ebenfalls die Frage, ob und wie die Konfrontation des Publikums mit extrem gewalttätigen fotografischen Darstellungen zulässig ist. Anhand der Beschreibung eines Projekts des chilenischen Küstlers Alfredo Jaar zeigt er, wie durch eine komplett andere und ungewohnte Anordnung von Bild und Text das Unerträgliche greifbar gemacht werden kann.
Charlotte Klonk wieder hat sich damit beschäftigt, wie Bilder Instrumente zur Verbreitung terroristischer Ideologien werden können. Sie spannt den Bogen dabei sehr weit, beginnend bei den russischen Narodniki. Fahndungsfotos, von der Staatsmacht zur Jagd auf die „Schurken“ verwendet, können ebensogut zu Ikonen mit Bildern von Freiheitskämpfern werden. Die Interpretation liegt auch hier im Auge des Betrachters – und oft genug hauen die Verfolger kräftig daneben, wenn sie die Gejagten erniedrigt oder geschunden zeigen. Das geht bis zu einer sehr interessanten Interpretation des berühmten Standbildes aus einem Homevideo Osama bin Ladens, das den „Godfather of terror“ als alten Mann mit TV-Fernbedienung zeigt, jämmerlich in seiner Isolation.
Tom Holert greift in „Evidenz-Effekte“ ein spannendes Thema auf, das den meisten Menschen durch die Populärkultur, vor allem durch Krimiserien, bekannt ist: die Gerichtssaalszenerie, in der ein smarter Verteidiger oder ein eloquenter Staatsanwalt durch neue visuelle Beweise die Stimmung der Geschworenen zum Kippen bringt. So argumentiert er, dass durch die protestantischen Bildverbote in der frühen Neuzeit potenziell alles Visuelle als Widerspruch zur Praxis der Rechtsprechung vermutet wurde. Anhand einer Fülle von Beispielen beschäftigt er sich damit, wie heute visuelle und theatralische Mittel in den Gerichtssälen eingesetzt werden – und nicht immer der Wahrheitsfindung dienen. Anhand von Beispielen zu TV-Auftritten des deutschen Verteidigungsministers Scharping während des Jugoslawien-Kriegs zeigt er, wie irreführend scheinbar schlüssige „visuelle“ Beweisführungen sein können.
David Company wiederum beschäftigt sich in einer Analyse der Fotoserie von Joel Meyerowitz über den „Ground Zero“ in New York mit der „späten Fotografie“, also Bildern, die keine Ereignisse, sondern deren Folgen zeigen.
Der 6. und vorletzte Abschnitt der „Theorie der Fotografie“ beschäftigt sich mit Social Media und dem Kommunizieren mit Bildern. Besonders verweisen möchte ich auf den Text des französischen Medienwissenschaftlers André Gunthert, der anhand des „Bürgerjournalismus“ rund um die islamistischen Attentate in London am 7. Juli 2005 zeigt, wie die sozialen Medien und ihre Möglichkeiten den traditionellen Bildjournalismus unterlaufen und verändern. Er weist nach, dass der Mythos von den „Amateurjournalisten“, die plötzlich die Profis von den Titelseiten verdrängen, Ausdruck eins Kampfs um berufliche Existenz ist. „Von den insgesamt 442 Titelseiten vom 8. Juli auf der Seite Newseum […] auf der die wichtigsten Zeitungen vereint sind, werden lediglich neun mit Amateurfotos illustriert […] ein Anteil von 2 %“. (S 358). Gunthert kommt zum Schluss, dass die Veröffentlichung von Fotos mit „Nachrichtenwert“ auf einer Plattform wie Flickr keineswegs bedeutet, dass die Fotograf*innen als Konkurrenten zu den „Berufsfotojpurnalisten“ auftreten wollen. Die Übernahme von Fotos durch große Medien kann vielmehr eher als ausbeuterischer Akt gesehen werden.
Schön auch der Text von Paul Frosh über das „Selfie. Das digitale Bild als Geste und Performance“. Angesichts der Selfieflut auf Plattformen wie Instagram oder Facebook gab und gibt es ja eine Tendenz zum Naserümpfen. Frosh beschreibt das Selfie als selbst-reflexiven Akt und hilft damit vielleicht ein bisschen dazu mit, das oft belächelte Kind der Handyfotogtrafie aus der fotografischen Schmuddelecke zu holen. Gleich angeschlossen findet sich ein weiterer Text Froshs, der sich mit dem Screenshot beschäftigt. Durchaus zutreffend bezeichnet der Autor den Screenshot als „Racheengel der Fotografie“. Brillant, wie er anhand einer Titelseite des israelischen Tageszeitung Yedioth Ahronoth zeigt, wie mächtig und tragisch die Wirkung eines Screenshots sein kann.
Das 7. und letzte Kapitel beschäftigt sich mit dem fotografischen Archiv – „Verwalten, Speichern, Verschwinden“. Herta Wolfs Beitrag über das „Denkmalarchiv Fotografie“ zeigt am Beispiel der „Königlichen Messbildanstalt“ zu Berlin, wie die Fotografie zum Instrument wurde, durch exakte Abbildungen Baudenkmäler „virtuell“ zu dokumentieren, durch die Zuordnung exakter Maße zu den Abbildungen die erfassten Bauten jederzeit rekonstruierbar zu machen. Von da ist es fast ein logischer Schritt zu den modernen Bildagenturen die versuchen, nicht nur aktuell ein „Bild der Welt im Maßstab 1:1“ anzubieten, um Umberto Eco zu paraphrasieren, sondern die wie Getty Images oder Corbis daran gegangen sind, das visuelle Erbe der Menschheit zu privatisieren und zum lizenzierbaren Objekt zu machen.
Katja Müller-Helles Essay über Bildzensur beschäftigt sich grundlegend mit einem Thema, das Nutzern „sozialer Medien“ vielleicht schon selbst schlaflose Nächte bereitet hat. Was kann, was darf gezeigt/verwendet werden? War früher die staatliche Zensur der Reibebaum für die grafischen Künste, sind es heute Algorithmen und die Geschftsinteressen mächtiger Medienkonzerne.
Abschließend beschäftigt sich Dennis Jelonnek mit der „mysteriösen Aura“ der Polaroidfotografie. Das Sofortbild stand von Anfang an unter dem Verdacht, dass es sich irgendwann quasi von selbst löschen würde. Tröstlich der Hinweis des Autors, dass sich das oft angekündigte „Verblassen und Verfärben“ der Polaroidfotos keineswegs zwangsläufig einstellt.
Klarerweise ist es weder die Absicht noch der Zweck einer Rezension, alle in einer Anthologie versammelten Beiträge zu behandeln. Dass ich doch etwas mehr ins Detail gegangen bin als üblich liegt daran, dass ich Peter Geimers „Theorie der Fotografie V“ für eine ganz bedeutende Neuerscheinung halte, die ich allen an Fotografie Interessierten ans Herz legen möchte. Nicht alle Texte erschließen sich bei der ersten Lektüre, einige erschließen sich vielleicht nie (was nicht unbedingt an der Leserin oder am Leser liegen muss!). Aber die einleitenden Bemerkungen des Herausgebers zu den einzelnen Abschnitten alleine würden den Erwerb des Buches schon rechtfertigen, weil sie ein nützlicher Kompass durch den Dschungel der zeitgenössischen Theorien zur Fotografie sind.
Der Schirmer/Mosel Verlag hat wieder ein gediegenes und buchgestalterisch vorbildliches Werk herausgebracht. Mein Tipp: ein ideales Geschenk für jede Fotografin und jeden Fotografen!
Kurt Lhotzky
Hsgb.: Peter Geimer
Theorie der Fotografie V (1995-2022)
Verlag: Schirmer/Mosel, 2023
Seitenanzahl: 450
Preis: 59,40 (AT), 58,– (D)


